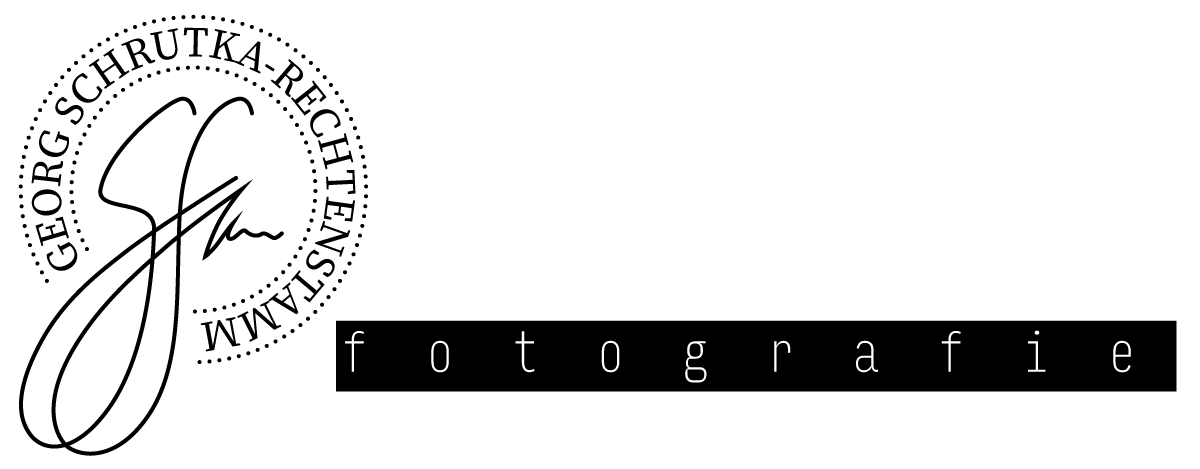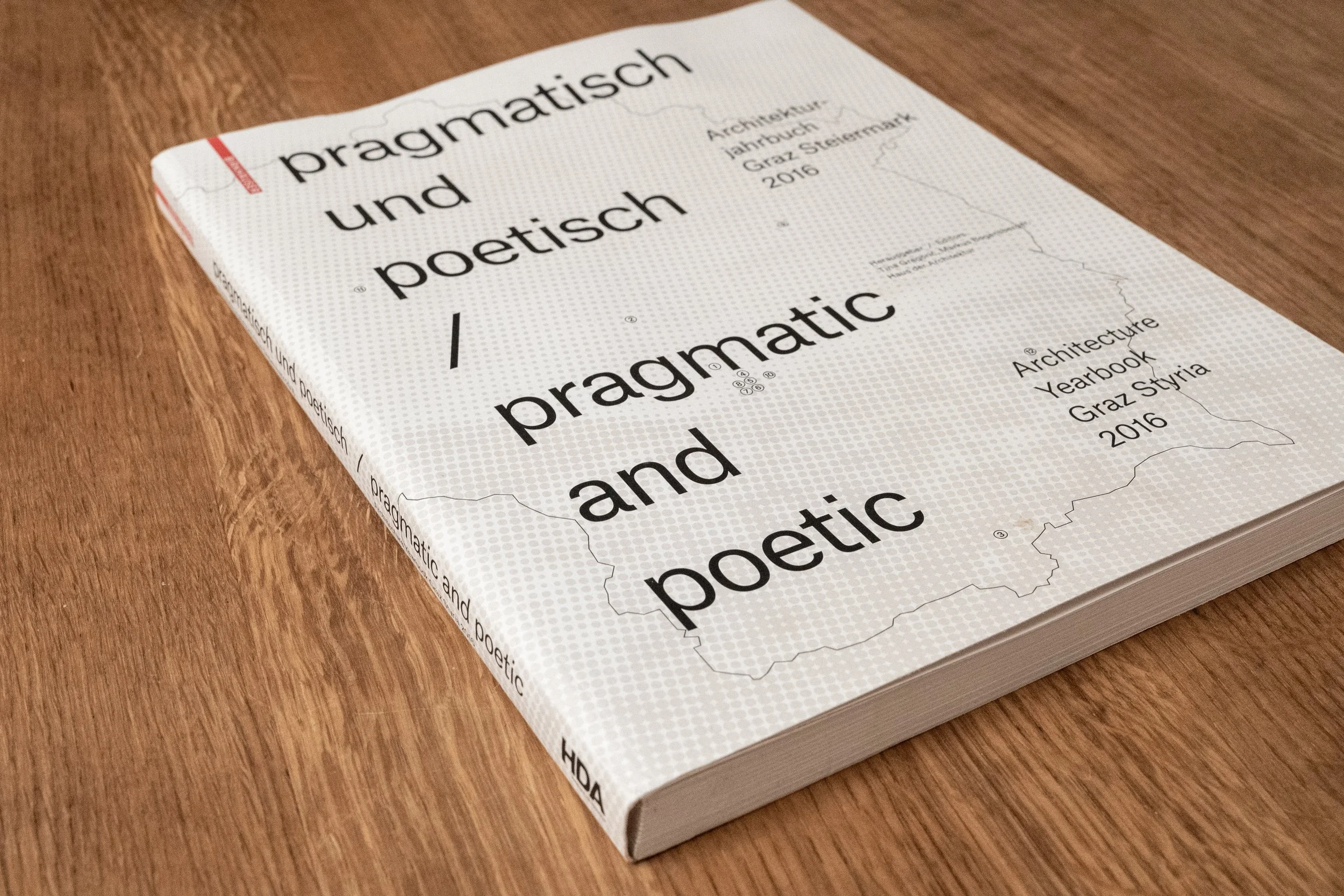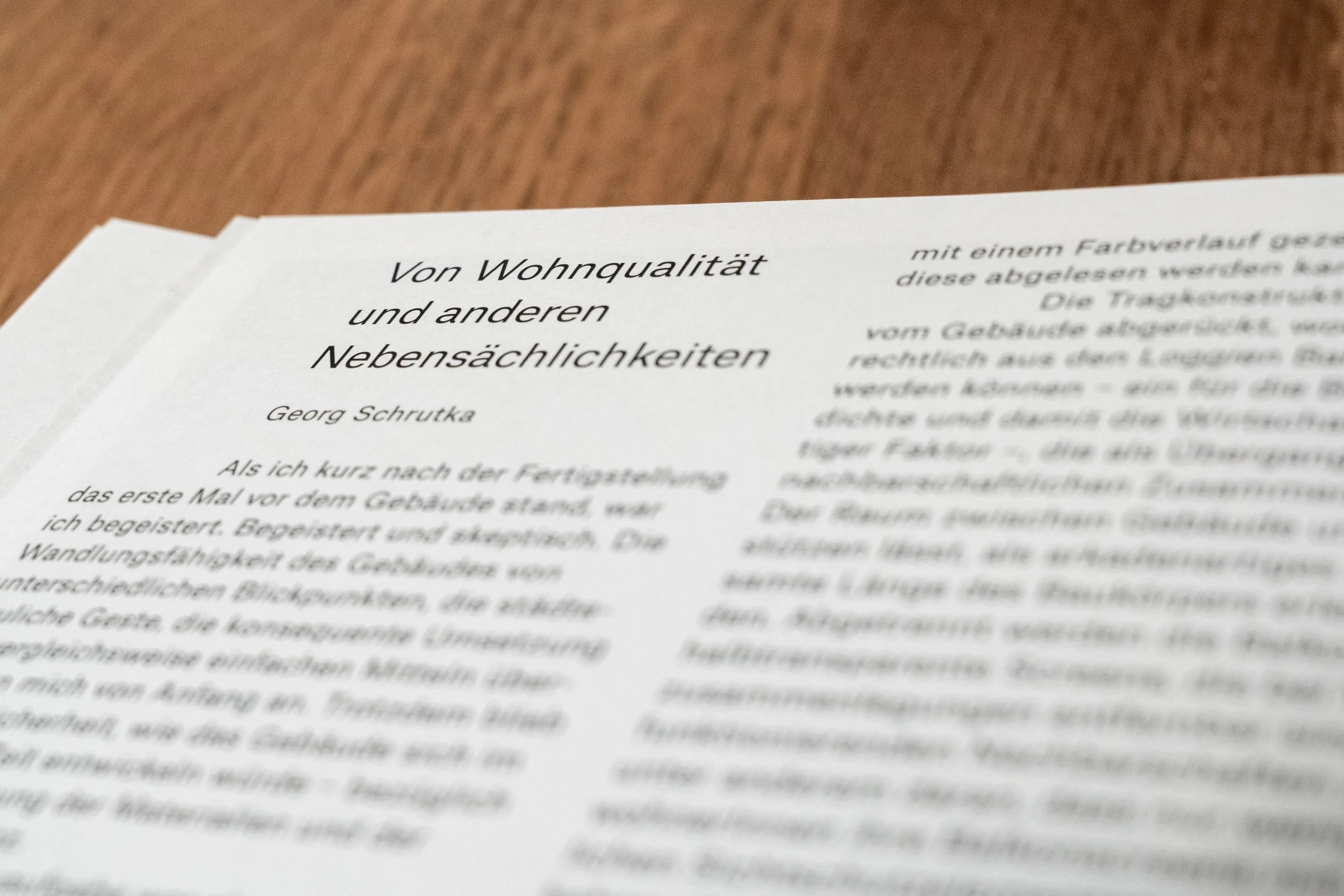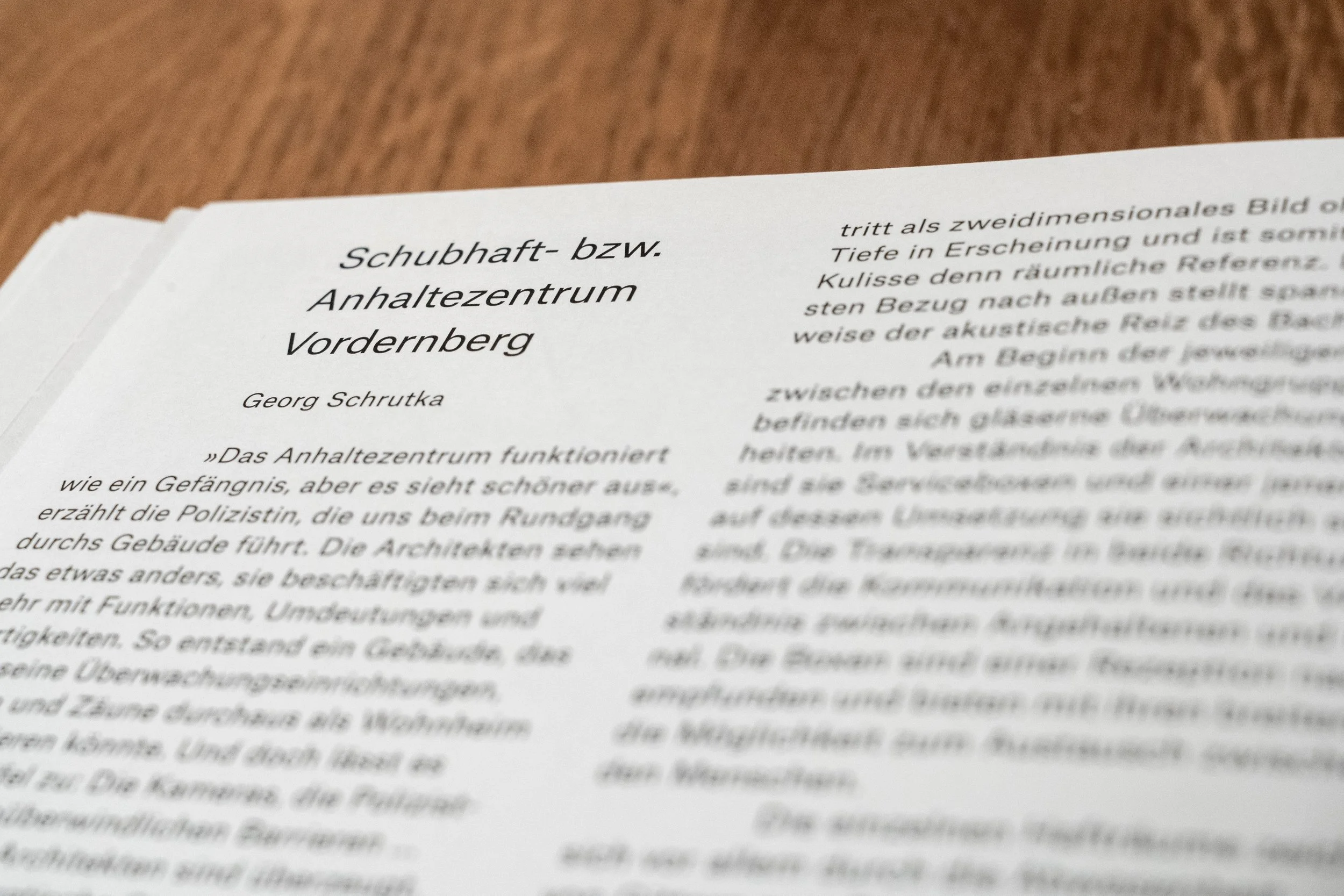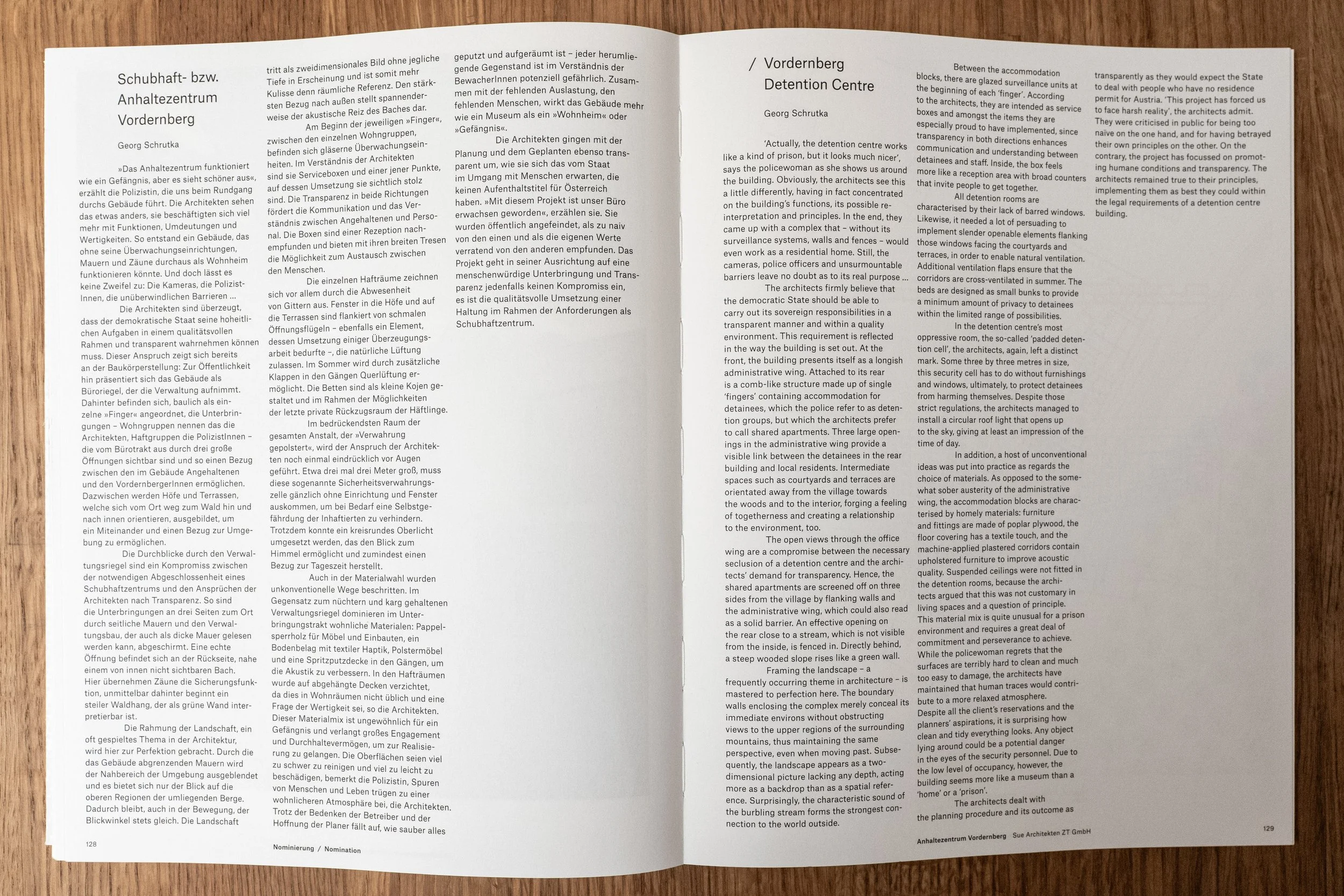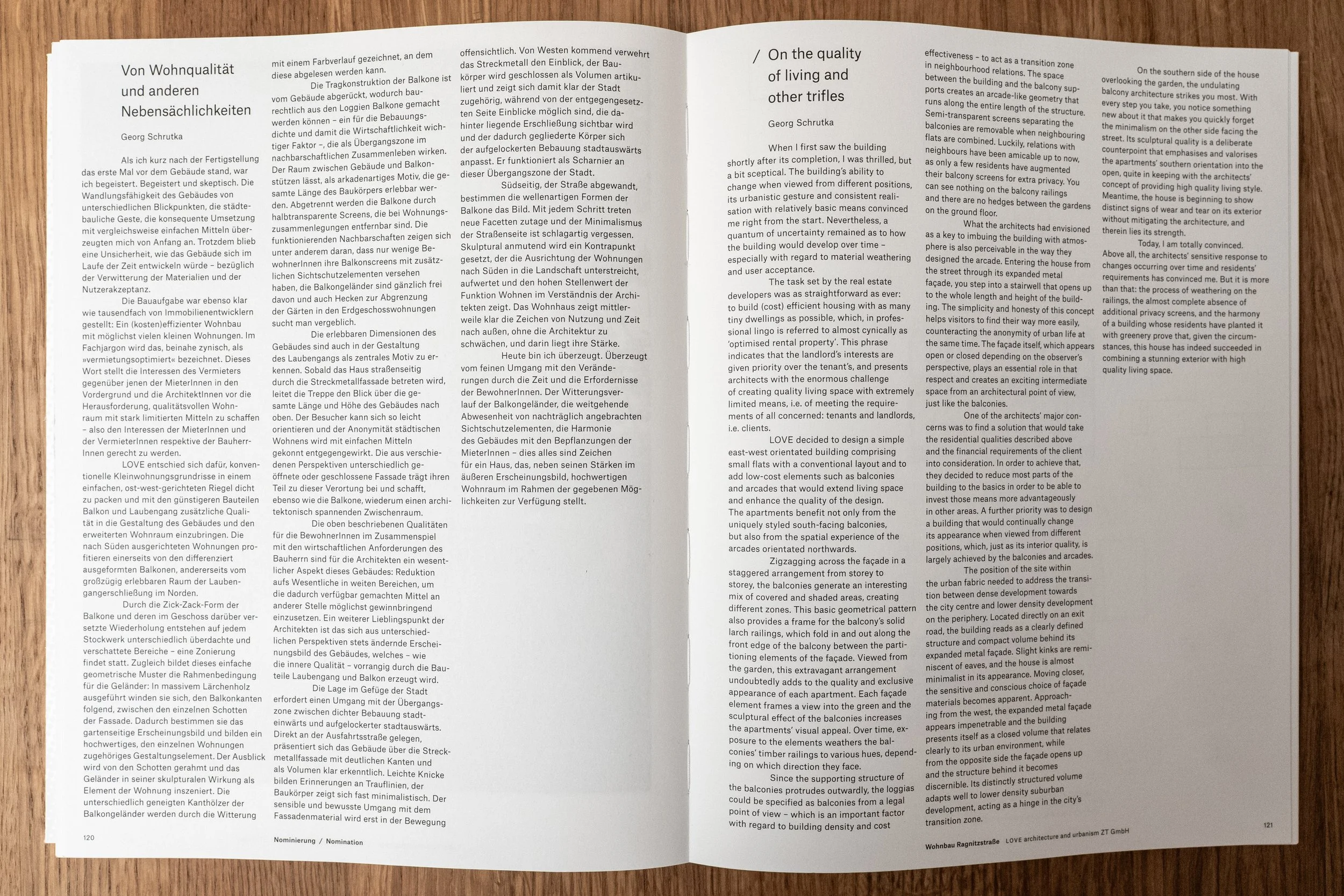pragmatisch und poetisch - Architekturjahrbuch Graz Steiermark 2016
Zwei Architekturkritiken
Kreative Leistung: Architekturkritik, zwei Texte
Beschriebenes Projekt: Wohnbau Ragnitzstraße, LOVE architecure and urbanism ZT GmbH
Beschriebenes Projekt: Anhaltezentrum Vordernberg, Sue Architekten ZT GmbH
Herausgeber: Tina Gregorič, Markus Bogensberger, Haus der Architektur
Verlag: Birkhäuser Verlag GmbH, Basel
Erscheinungsjahr: 2017
Schubhaft- bzw. Anhaltezentrum Vordernberg | Georg Schrutka | „Das Anhaltezentrum funktioniert wie ein Gefängnis, aber es sieht schöner aus“, erzählt die Polizistin, die uns beim Rundgang durchs Gebäude führt. Die Architekten sehen das etwas anders, sie beschäftigten sich vielmehr mit Funktionen, Umdeutungen und Wertigkeiten. So entstand ein Gebäude, das ohne seine Überwachungseinrichtungen, Mauern und Zäune durchaus als Wohnheim funktionieren könnte. Und doch lässt es keine Zweifel zu: Die Kameras, die Polizist:innen, die unüberwindlichen Barrieren. | Die Architekten sind überzeugt, dass der demokratische Staat seine hoheitlichen Aufgaben in einem qualitätsvollen Rahmen und transparent wahrnehmen können muss. Dieser Anspruch zeigt sich bereits an der Baukörperstellung: Zur Öffentlichkeit hin präsentiert sich das Gebäude als Bürotrakt, der die Verwaltung aufnimmt. Dahinter befinden sich, baulich als einzelne „Finger“ angeordnet, die Unterbringungen – Wohngruppen nennen das die Architekten, Haftgruppen die Polizist:innen – vom Bürotrakt aus durch drei große Öffnungen sichtbar sind und so einen Bezug zwischen den im Gebäude Angehaltenen und den Vordernberger:innen ermöglichen. Dazwischen werden Höfe und Terrassen, welche sich vom Ort weg zum Wald hin und nach innen orientieren, ausgebildet, um ein Miteinander und einen Bezug zur Umgebung zu ermöglichen. | Die Durchblicke durch den Verwaltungsriegel sind ein Kompromiss zwischen der notwendigen Abgeschlossenheit eines Schubhaftzentrums und den Ansprüchen der Architektur auf Transparenz. So sind die Unterbringungen an drei Seiten zum Ort durch seitliche Mauern und den Verwaltungsbau, der auch als dicke Mauer gelesen werden kann, abgeschirmt. Eine echte Öffnung befindet sich an der Rückseite, nahe einem von innen nicht sichtbaren Bach. Hier übernehmen Zäune die Sicherungsfunktion, unmittelbar dahinter beginnt ein steiler Waldhang, der als grüne Wand interpretierbar ist. | Die Rahmung der Landschaft, ein oft gespieltes Thema in der Architektur, wird hier zur Perfektion gebracht. Durch die das Gebäude abgrenzenden Mauern wird der Nahbereich der Umgebung ausgeblendet und es bietet sich nur der Blick auf die oberen Regionen der umliegenden Berge. Dadurch bleibt, auch in der Bewegung, der Blickwinkel stets gleich. Die Landschaft tritt als zweidimensionales Bild ohne jegliche Tiefe in Erscheinung und ist somit mehr Kulisse denn räumliche Referenz. | Den stärksten Bezug nach außen stellt die akustische Präsenz des Baches dar. An den Übergängen der „Finger“, zwischen den einzelnen Wohngruppen, befinden sich gläserne Überwachungseinheiten. Im Verständnis der Architekten sind sie Serviceboxen und einer jener Punkte, auf dessen Umsetzung sie sichtlich stolz sind. Die Transparenz in beide Richtungen fördert die Kommunikation und das Verständnis zwischen Angehaltenen und Personal. Die Boxen sind einer Rezeption nachempfunden und bieten mit ihren breiten Tresen die Möglichkeit zum Austausch zwischen den Menschen. | Die einzelnen Hafträume zeichnen sich vor allem durch die Abwesenheit von Gittern aus. Fenster in die Höfe und auf die Terrassen sind flankiert von schmalen Öffnungsflügeln – ebenfalls ein Element, dessen Umsetzung einiger Überzeugungsarbeit bedurfte –, die natürliche Lüftung zulassen. Im Sommer wird durch zusätzliche Klappen in den Gängen Querlüftung ermöglicht. Die Betten sind als kleine Kojen gestaltet und im Rahmen der Möglichkeiten der letzte private Rückzugsraum der Häftlinge. | Im bedrückendsten Raum der gesamten Anstalt, der „Verwahrungszelle“, wird der Anspruch der Architekten noch einmal eindrücklich vor Augen geführt. Etwa drei mal drei Meter groß, muss diese sogenannte Sicherheitsverwahrungszelle gänzlich ohne Einrichtung und Fenster auskommen, um bei Bedarf eine Selbstgefährdung der Inhaftierten zu verhindern. Trotzdem konnte ein kreisrundes Oberlicht umgesetzt werden, das den Blick zum Himmel ermöglicht und zumindest einen Bezug zur Tageszeit herstellt. | Auch in der Materialwahl wurden unkonventionelle Wege beschritten. Im Gegensatz zum nüchtern und karg gehaltenen Verwaltungsriegel dominieren im Unterbringungstrakt wohnliche Materialien: Pappelsperrholz für Möbel und Einbauten, ein Bodenbelag mit textiler Haptik, Polstermöbel und eine Spritzputzdecke in den Gängen, um die Akustik zu verbessern. In den Hafträumen wurde auf abgehängte Decken verzichtet, da dies in Wohnräumen nicht üblich und eine Frage der Wertigkeit sei, so die Architekten. | Dieser Materialmix ist ungewöhnlich für ein Gefängnis und verlangt großes Engagement und Durchhaltevermögen, um zur Realisierung zu gelangen. Die Oberflächen seien viel zu empfindlich, bemerkt die Polizistin, Spuren würden sich zu schnell zeigen. Doch tragen sie auch zur Atmosphäre bei, die das Gebäude ausstrahlt. | Trotz der Bedenken der Betreiber und der Hoffnung der Planer fällt auf, wie sauber alles geputzt und aufgeräumt ist – jeder herumliegende Gegenstand ist im Verständnis der Bewacher:innen potenziell gefährlich. Zusammen mit der fehlenden Auslastung, den fehlenden Menschen, wirkt das Gebäude mehr wie ein Museum als ein „Wohnheim“ oder „Gefängnis“. | Die Architekten gingen mit der Planung und dem Geplanten ebenso transparent um, wie sie sich das vom Staat im Umgang mit Menschen erwarten, die keinen Aufenthaltstitel für Österreich haben. „Mit diesem Projekt ist unser Büro erwachsen geworden“, erzählen sie. Sie wurden öffentlich angefeindet, als zu naiv von den einen und als die eigenen Werte verratend von den anderen empfunden. Das Projekt geht in seiner Ausrichtung auf eine menschenwürdige Unterbringung und Transparenz jedenfalls keinen Kompromiss ein, es ist die qualitätsvolle Umsetzung einer Haltung im Rahmen der Anforderungen als Schubhaftzentrum. |
Von Wohnqualität und anderen Nebensächlichkeiten | Georg Schrutka | Als ich kurz nach der Fertigstellung das erste Mal vor dem Gebäude stand, war ich begeistert. Begeistert und skeptisch. Die Wandlungsfähigkeit des Gebäudes von unterschiedlichen Blickpunkten, die städtebauliche Geste, die konsequente Umsetzung mit vergleichsweise einfachen Mitteln überzeugten mich von Anfang an. Trotzdem blieb eine Unsicherheit, wie das Gebäude sich im Laufe der Zeit entwickeln würde – bezüglich der Verwitterung der Materialien und der Nutzerakzeptanz. | Die Bauaufgabe war ebenso klar wie tausendfach von Immobilienentwicklern gestellt: Ein (kosten)effizienter Wohnbau mit möglichst vielen kleinen Wohnungen. Im Fachjargon wird das, beinahe zynisch, als „vermietungsoptimiert“ bezeichnet. Dies stellt die Interessen des Vermieters gegenüber jenen der Mieter:innen in den Vordergrund und die Architekt:innen vor die Herausforderung, qualitätsvollen Wohnraum mit stark limitierten Mitteln zu schaffen – also den Interessen der Mieter:innen und der Vermieter:innen respektive der Bauherr:innen gerecht zu werden. | LOVE entschied sich dafür, konventionelle Kleinwohnungsgrundrisse in einem einfachen, ost-west-gerichteten Riegel dicht zu packen und mit den günstigeren Bauteilen Balkon und Laubengang zusätzliche Qualität in die Gestaltung des Gebäudes und den erweiterten Wohnraum einzubringen. | Die nach Süden ausgerichteten Wohnungen profitieren einerseits von den differenziert ausgeformten Balkonen, andererseits vom großzügig erlebbaren Raum der Laubengangerschließung im Norden. | Durch die Zick-Zack-Form der Balkone und deren im Geschoss darüber versetzte Wiederholung entstehen auf jedem Stockwerk unterschiedlich überdachte und verschattete Bereiche – eine Zonierung findet statt. Zugleich bildet dieses einfache geometrische Muster die Rahmenbedingung für die massiven Lärchenholzgeländer: Ausgeführt winden sie sich, den Balkonkanten folgend, zwischen den einzelnen Schotten der Fassade. Dadurch bestimmen sie das Erscheinungsbild der Gartenseite und bilden ein hochwertiges, den einzelnen Wohnungen zugehöriges Gestaltungselement. Der Ausblick wird von den Schotten gerahmt und das Balkongeländer in seiner skulpturalen Wirkung als Element der Wohnung inszeniert. Die unterschiedlich geneigten Kanthölzer der Balkongeländer werden durch die Witterung mit einem Farbverlauf gezeichnet, an dem diese abgelesen werden kann. | Die Tragstruktur der Balkone ist vom Gebäude abgerückt, wodurch baurechtlich aus den Loggien Balkone gemacht werden können – ein für die Bebauungsdichte und damit die Wirtschaftlichkeit wichtiger Faktor –, die als Übergangszone im nachbarschaftlichen Zusammenleben wirken. Der Raum zwischen Gebäude und Balkonstützen lässt, als arkadenartiges Motiv, die gesamte Länge des Baukörpers erlebbar werden. Abgetrennt werden die Balkone durch halbtransparente Screens, die bei Wohnungszusammenlegungen entfernbar sind. Die funktionierenden Nachbarschaften zeigen sich unter anderem daran, dass nur wenige Bewohner:innen ihre Balkonscreens mit zusätzlichen Sichtschutzelementen versehen haben, die Balkongeländer sind gänzlich frei davon und auch Hecken zur Abgrenzung der Gärten in den Erdgeschosswohnungen sucht man vergeblich. | Die erlebbaren Dimensionen des Gebäudes sind auch in der Gestaltung des Laubengangs als zentrales Motiv zu erkennen. Sobald das Haus straßenseitig durch die Streckmetallfassade betreten wird, leitet die Treppe den Blick über die gesamte Länge und Höhe des Gebäudes nach oben. Der Besucher kann sich so leicht orientieren und der Anonymität städtischen Wohnens wird mit einfachen Mitteln gekonnt entgegengewirkt. Die aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich geöffnete oder geschlossene Fassade trägt ihren Teil zu dieser Verortung bei und schafft ebenso wie die Balkone wiederum einen architektonisch spannenden Zwischenraum. | Die oben beschriebenen Qualitäten für die Bewohner:innen im Zusammenspiel mit den wirtschaftlichen Anforderungen des Bauherrn sind für die Architekten ein wesentlicher Aspekt dieses Gebäudes: Reduktion aufs Wesentliche in weiten Bereichen, um die dadurch verfügbar gemachten Mittel an anderer Stelle möglichst gewinnbringend einzusetzen. Ein weiterer Lieblingspunkt der Architekten ist das sich aus unterschiedlichen Perspektiven stets ändernde Erscheinungsbild des Gebäudes, welches – wie die innere Qualität – vorrangig durch die Bauteile Laubengang und Balkon erzeugt wird. | Die Lage im Gefüge der Stadt erfordert einen Umgang mit der Übergangszone zwischen dichter Bebauung stadteinwärts und aufgelockerter Bebauung stadtauswärts. Direkt an der Ausfahrtsstraße gelegen, präsentiert sich das Gebäude über die Streckmetallfassade mit deutlichen Kanten und als Volumen klar erkenntlich. Leichte Knicke bilden Erinnerungen an Trauflinien, der Baukörper zeigt sich fast minimalistisch. Der sensible und bewusste Umgang mit dem Fassadenmaterial wird erst in der Bewegung offensichtlich. | Von Westen kommend verwehrt das Streckmetall den Einblick, der Baukörper wird geschlossen als Volumen artikuliert und zeigt sich damit klar der Stadt zugehörig, während von der entgegengesetzten Seite Einblicke möglich sind, die dahinter liegende Erschließung sichtbar wird und der dadurch gegliederte Körper sich der aufgelockerten Bebauung stadtauswärts anpasst. Er funktioniert als Scharnier an dieser Übergangszone der Stadt. | Südseitig, der Straße abgewandt, bestimmen die wellenartigen Formen der Balkone das Bild. Mit jedem Schritt treten neue Facetten zutage und der Minimalismus der Straßenseite ist schlagartig vergessen. Skulptural anmutend wird ein Kontrapunkt gesetzt, der die Ausrichtung der Wohnungen nach Süden in die Landschaft unterstreicht, aufwertet und den hohen Stellenwert der Funktion Wohnen im Verständnis der Architekten zeigt. Das Wohnhaus zeigt mittlerweile klar die Zeichen von Nutzung und Zeit nach außen, ohne die Architektur zu schwächen, und darin liegt ihre Stärke. | Heute bin ich überzeugt. Überzeugt vom feinen Umgang mit den Veränderungen durch die Zeit und die Erfordernisse der Bewohner:innen. Der Witterungsverlauf der Balkongeländer, die weitgehende Abwesenheit von nachträglich angebrachten Sichtschutzelementen, die Harmonie des Gebäudes mit den Bepflanzungen der Mieter:innen – dies alles sind Zeichen für ein Haus, das neben seinen Stärken im äußeren Erscheinungsbild hochwertigen Wohnraum im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zur Verfügung stellt. |